Wilhelm Pinder: Deutscher Barock (1912)
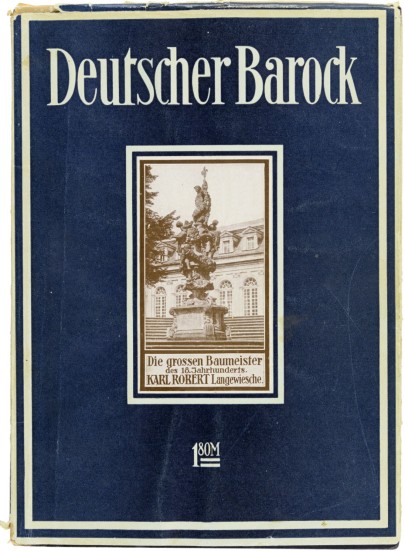
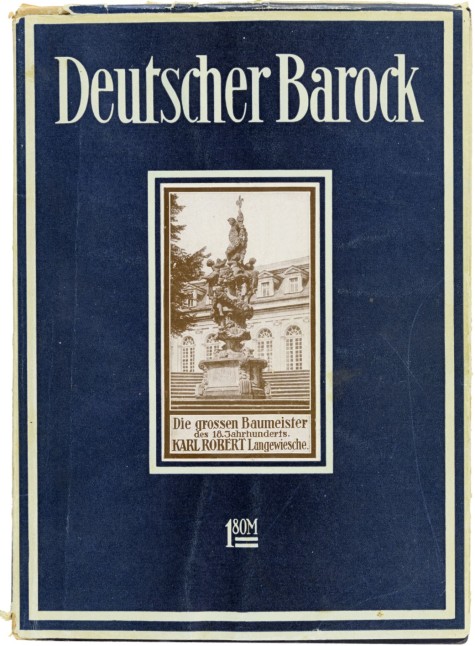
Wilhelm Pinder (1878–1947) war im Vergleich zu anderen Lehrstuhlinhabern nur relativ kurze Zeit in Darmstadt, fünf Jahre von 1910–1915: Es war eine Durchgangsstation auf der „großen Karriere“, die ihn über Breslau, Leipzig und München zuletzt bis nach Berlin (ab 1935) führte. Pinder ist vermutlich der in der Kunstgeschichte bis heute bekannteste und umstrittenste Vertreter seines Fachs an der TH.
In den Darmstädter Jahren entstand vor allem ein Buch, das bis heute viel zitiert wird und seinen Ruhm begründete, bevor dieser sich im Rückblick durch stets zunehmende nationalistische und völkische Deutungsmuster wieder verdunkelte. Der schmale Band „Deutscher Barock – die großen Baumeister des 18. Jahrhunderts“ erschien 1912 im damals noch in Düsseldorf, später in Königstein firmierenden Verlag Robert Langewiesche in der Reihe „Die blauen Bücher“. Bis 1965 folgten 14 Auflagen, es handelt sich somit um einen Best- und Longseller. Der große Publikumserfolg – schon die erste Auflage umfasste 30.000 Exemplare – steht in direktem Zusammenhang mit der Konzeption der Buchreihe: Wenig Text, viele hochqualitative Schwarz-Weiß-Tafeln und ein schlankes, heftartiges A5-Format mit Soft-Cover. Es handelte sich also um eine dezidiert populärwissenschaftliche Reihe, die nicht die Fachkollegien, sondern eine breite Öffentlichkeit adressierte. Und genau darin bewies Pinder seine besonderen rhetorischen und suggestiven Fähigkeiten.
Hans Gerhard Evers: Staat aus dem Stein. Denkmäler Geschichte und Bedeutung der ägyptischen Plastik während des Mittleren Reichs, 2 Bde., München 1929


Während seiner Zeit als Assistent des Heidelberger Ägyptologen Hermann Ranke erarbeitete Evers ein zweibändiges Werk über die ägyptische Plastik des Mittleren Reichs, das zugleich seine erste monographische Publikation darstellt. Hervorgegangen ist die Arbeit aus einer Forschungsreise Evers nach Ägypten im Wintersemester 1925/26, die von der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft sowie dem US-amerikanischen Mäzen John M. Wulfing finanziert wurde. Der erste Band umfasst katalogartig 148 s/w-Tafeln von altägyptischer Plastik, ergänzt um einige Architektur- und Landschaftsaufnahmen, sowie auf rund 110 Seiten eine kunstgeschichtliche Abhandlung über die Plastik des Mittleren Reichs. Der erste Band war laut Evers auch an ein nichtwissenschaftliches Publikum gerichtet. Die hauptsächlich Datierungsfragen erörternden Ausführungen, die sich an Fachwissenschaftler*innen wenden, fasste Evers deshalb im Stile längerer Fußnoten im zweiten Band zusammen. Das zweibändige Werk beansprucht demnach, Dokumentation, allgemeinverständliche Kunstgeschichte und wissenschaftliche Untersuchung der Plastik des Mittleren Reichs zugleich zu sein.
Ottilie Rady: Das weltliche Kostüm von 1250–1410 nach Ausweis der figürlichen Grabsteine im mittelrheinischen Gebiet, Dachau 1976 (Privatdruck)
Das Buch mit dem, wie Ottilie Rady selbst schreibt, etwas umständlichen Titel „Das weltliche Kostüm von 1250–1410 nach Ausweis der Grabsteine im mittelrheinischen Gebiet“ ist ihre Dissertation mit der sie 1922 bei Rudolf Kautzsch an der Universität Frankfurt promoviert wurde. Das Ziel war mit Hilfe der Erforschung der mittelalterlichen Kleidung der Figuren auf den mittelalterlichen Grabsteinen, die ja in der Regel datiert waren, der zukünftigen Kunstgeschichte eine Datierungshilfe für andere Kunstwerke an die Hand zu geben. Dabei wendete Rady eine von ihrem früheren Professor Paul Clemen in Bonn benutzte Methode an, der ebenfalls Datierungsfragen in seiner Mittelalterforschung mithilfe der Kostümkunde bearbeitete. Ein ähnliches Thema hatte die Clemen-Schülerin Aenne Liebreich in ihrer Dissertation „Kostümgeschichtliche Studien zur kölnischen Malerei des 14. Jahrhunderts“ angewendet. Die Wahl des kostümgeschichtlichen Themas durch Rady sollte man also nicht vorschnell als typisch weibliches Forschungsthema einordnen, sondern als kunsthistorische Methode der Bonner Clemen-Schule ansehen.

Bildtafel VII aus der Publikation „Das weltliche Kostüm von 1250-1410“, mit aquarellierten Zeichnungen von mittelalterlichen Wandgemälden und Miniaturen von Ottilie Rady
Hans Gerhard Evers: Tod, Macht und Raum als Bereiche der Architektur, München 1939
Unter den titelgebenden Oberbegriffen „Tod, Macht und Raum“ fasste Hans Gerhard Evers in dem 1939 publizierten Buch verschiedene Studien zur Architekturgeschichte in Form von in sich geschlossenen Kapiteln zusammen, darunter seine 1932 in München angenommene Habilitationsschrift über die „Breitrichtung der Basilika“. Weitere Kapitel behandeln etwa das Grabmal des Theoderich in Ravenna oder das romanische Stufenportal [zeittypisch im Singular verallgemeinert], aber auch eine Diskussion über den Denkmalbegriff bei Georg Dehio und Alois Riegl sowie eine längere Studie zu Herrenchiemsee, die offenbar den Grundstock für Evers’ fast 50 Jahre später erschienene Publikation über Ludwig II. von Bayern bildete. Mit der enormen zeitlichen Spannweite von der Spätantike bis in das frühe 20. Jahrhundert wie auch der thematischen Bandbreite vom herrschaftlichen Grabbau bis zur zeitgenössischen Denkmalpflegetheorie steht das Buch geradezu exemplarisch für die erstaunliche Vielseitigkeit des Forschers Evers.
Koch: Die großen deutschen Maler. Die Geschichte ihrer Kunst vom 9. bis 20 Jahrhundert, 1962
Das Buch „Die großen deutschen Maler: Die Geschichte ihrer Kunst vom 9. bis 20. Jahrhundert“ von Georg Friedrich Koch ist ein stattlicher Bildband, dessen Illustrationen komplett in Farbe reproduziert wurden – eine echte Seltenheit in den 1960er Jahren. Mit einer Rückenhöhe von 32,8 cm enthält der Band knapp 140 großformatige Bildtafeln von Zeichnungen und Gemälden aus zwölf Jahrhunderten. Während den Abbildungen ein kontextualisierender Einleitungstext vorgeschaltet ist, werden die Kunstwerke in einem abschließenden Textblock einzeln vorgestellt, ganz ähnlich der Struktur, wie sie beispielsweise in den ab 1966 erschienenen Bänden der weithin bekannten Reihe PROPYLÄEN KUNSTGESCHICHTE, einem deutschsprachigen Standardwerk zur Kunstgeschichte und Archäologie, umgesetzt wurde.
Anders als der Titel vielleicht suggerieren mag, handelt es sich bei dem Buch nicht um eine Publikation mit einem Fokus auf den Biographien der Maler, sondern ein Überblickswerk über die Malkunst im Gebiet des heutigen Deutschlands und ihrer Bedeutung. Der Bildband „möchte“, so Georg Friedrich Koch einleitend, „an bedeutenden Beispielen der Malerei die Frage nach der Eigenart und Größe des Deutschen in der Kunst stellen, des Deutschen als eines integrierenden Elements, als eines Teilschicksals der europäischen Kunst“ (S. 6). Es sei nicht beabsichtigt, eine führende oder nicht führende Rolle der deutschen Malerei herauszuarbeiten. Vielmehr soll die eigene geschichtliche Entwicklung methodisch als Maßstab für den Rang der Kunst herangezogen werden.
Hans Lehmberg: Haar und Frisur in der bildenden Kunst


„Haar und Frisur in der bildenden Kunst“ erschien 1983, acht Jahre nach Hans Lehmbergs Emeritierung. Das Büchlein ist keine kunsthistorische Publikation im eigentlichen Sinne und möchte das auch nicht sein. Es ist vielmehr Ausdruck der lebenslangen Faszination Lehmbergs für die bildende Kunst und seiner besonderen Perspektive auf dieselbe, die ganz von seiner Berufung, der Vermittlung des Friseurhandwerks im Kontext der Gewerbelehrer*innenausbildung, geprägt ist.
Die Ausstattung des Büchleins ist gemessen an seinem Umfang opulent. Zwischen golden schimmernden Buchdeckeln aus festem Karton präsentiert sich der Innenteil reich an Farbabbildungen, die sich mit dem Textanteil etwa die Waage halten. Mittig am unteren Rand des Buchdeckels verweist das Logo des Wella-Konzerns auf die Zusammenarbeit Lehmbergs mit dem Unternehmen, das die Publikation finanzierte und herausgab. Lehmberg, der während seiner Jahre an der TH Darmstadt vielfach mit Wella kooperierte, hielt diesen Kontakt offenbar auch noch nach seiner Emeritierung aufrecht.
Hans Gerhard Evers/Klaus Eggert: Ludwig II. von Bayern. Theaterfürst – König – Bauherr: Gedanken zum Selbstverständnis, München 1986


Im 100. Todesjahr des bayerischen Märchenkönigs kam 1986 das von Hans Gerhard Evers verfasste Buch über Ludwig II. als Theaterfürsten, König und Bauherrn heraus. In einer klugen Analyse brachte der Autor architektonische und künstlerische Zeugnisse sowie Ego-Dokumente und Objekte aus dem persönlichen Umfeld des Bayernkönigs zusammen. Einem grundlegenden Kapitel über die Kronprinzenzeit Ludwigs folgen die drei Hauptkapitel „Theaterfürst“, „König“ und „Bauherr“, in denen das Selbstverständnis des Monarchen als Zentrum von Ideen dargelegt wird, aus denen die Theateraufträge, dann die Freundschaft zum Komponisten Richard Wagner sowie die Schlossbauten hervorgehen. Evers hatte für diese Publikation auch in den Tagebüchern Ludwigs im Geheimen Hausarchiv der Wittelsbacher gelesen. Infolge einer beginnenden Alzheimererkrankung konnte Evers die Veröffentlichung des Buches nicht mehr selbst vornehmen. Unter der Herausgeberschaft von J. A. Schmoll gen. Eisenwerth wurde daher die Drucklegung durch Klaus Eggert besorgt.











