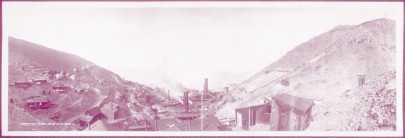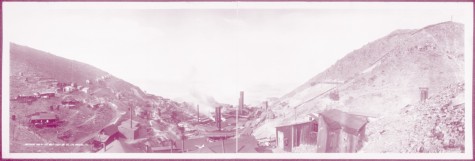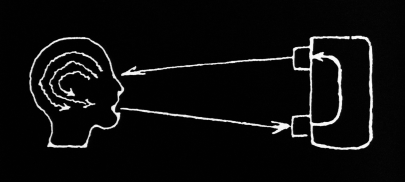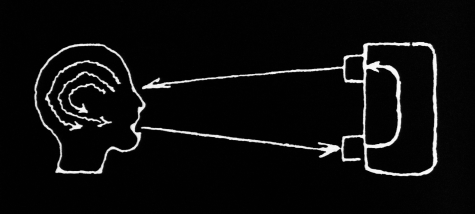Sommersemester 2025
Bachelor
Oliver Sukrow
Schon vor ihrer Gründung 1776 spielte das Verhältnis zwischen Technik (als Fortschrittsinstrument) und Natur (v.a. als Landschaft) in den Vereinigten Staaten von Amerika eine besondere Rolle. Gerade die bildende Kunst – und schon immer auch die Architektur – war hierfür zentral, weil hier Geisteshaltungen, Ideen und Konzepte in konkrete Werke übersetzt und damit breit lesbar gemacht wurden. Wir wollen uns deswegen im Seminar im historischen Längsschnitt mit den Überschneidungen von technischem Fortschritt (Eisenbahnen, Parkways, etc.), künstlerischer Repräsentation (Gemälde, Gärten / Architektur, etc.) und (scheinbar) natürlichen Gegebenheiten (Nationalparks, Landschaftsarchitektur, etc.) beschäftigen und fragen, inwiefern hier typisch ‚amerikanische‘ Phänomene entstanden sind. Dabei sollen auch der Umgang mit der indigenen Bevölkerung und die Geschichte der Sklaverei in den USA immer wieder eingeflochten werden. Der zentrale Ausgangspunkt für uns ist die Lektüre von Leo Marx’ (1919-2022) klassischem Text „The Machine in the Garden“ (1964), in dem dieser das Verhältnis von Technologie und Kultur im 19. und 20. Jahrhundert analysiert. Wir wollen Marx’ Text mit Beispielen aus Vergangenheit und Gegenwart und auf einer breiten geografischen Basis kritisch aktualisieren und ergänzen.
Vorgesehen ist auch eine Exkursion: Städel Frankfurt, Sonderausstellung „Frankfurt forever! Fotografien von Carl Friedrich Mylius“
Bachelor Seminar
Termine
immer montags von 10:30 bis 12:00 Uhr
28. April 2025 von 10:30 bis 12:00 Uhr
Einführungsveranstaltung im ATW Seminarraum (L3|01 315)
Exkursion voraussichtlich in KW 19
Catherine Greiner und Katharina Reibling
Angesichts der wachsenden Herausforderungen, vor denen die heutige Raumpraxis steht, wird es immer wichtiger, eine Lesefähigkeit für die komplexen Zusammenhänge der Orte zu schulen, an denen wir wirken. Verstehen bedeutet Bezüge herzustellen: persönlich, gemeinsam, emotional, praxisbasiert.
Wie beeinflussen Essenskulturen und kulinarische Prozesse das Erleben des Stadtraums?
Urban Foraging (das Suchen, Identifizieren und Sammeln von Wildpflanzen im Stadtraum) befasst sich unmittelbar mit den vorgefundenen Pflanzengemeinschaften und Fermentation (Gärprozesse) konserviert, während sich Materie transformiert. Kollektive Praktiken wie diese beinhalten eine tiefgreifende Ethik des Umgangs mit der Umgebung und mit dem Gegenüber. Sie stellen die Grenzen des (menschlichen) Körpers, des (essbaren) Materials und des (umschlossenen) Raumes in Frage. In Wechselwirkung zueinander machen sie den Körper und Boden, Organismus und Erde, erlebbar.
An drei Workshoptagen werden wir gemeinsam lesen und durch die Stadt streifen, entlang den Spuren der Urbanisierung. Wir werden die geschmacklichen Charakteristika und die ökologischen und sozialen Verflechtungen, die urbane Ort formen, erkunden. Sensorik, Intuition, mündliche Überlieferungen und den Tastsinn stellen wir über visuelle Beurteilungen und Clean Aesthetics.
Die Workshoptage münden jeweils in das Zubereiten und Teilen der Erkenntnisse (zu Literatur und Praxis) in einer gemeinsam kreierten Dinner-Situation.
The kitchen table as a starting point to reunite and visualize a possible framework of action that can help us overcome current and future global crises (…) and that connects us directly with the soil under us. (Tierra Sostenible, 2022)
Mit Eating Earth starten wir einen Versuch, durch Essen, Zubereitung und radikalem Teilen ein Ortsgefühl zu entwickeln.
Bachelor Seminar (Blockveranstaltung)
Termine
25. April 2025 um 10:00 Uhr
Einführungsveranstaltung via Zoom
16. Mai 2025
20. Mai 2025
6. Juni 2025
20. Juni 2025
4. Juli 2025
Viktoria Gont
Der Architektur, als einem „schweren“ Kommunikationsmedium (Fischer, 2010), kommt eine besondere Rolle unter den Kunstgattungen zu. Sie kann gezielt als politisches Instrument eingesetzt werden und auf diese Weise gesellschaftliche Prozesse lenken. Im Seminar wird unter anderem untersucht, wie Architektur, Bauwesen und Stadtplanung in den Dienst der nationalsozialistischen Diktatur gestellt wurden und welche Ziele man damit verfolgte. Anhand von vielfältigen Beispielen werden sowohl ästhetische als auch ethische Aspekte diskutiert. Es werden Schlüsselprojekte von Monumentalbauten bis zu Wohnsiedlungen analysiert und deren ideologische Funktion herausgestellt. Da der Umgang mit dem baulichen Erbe des Nationalsozialismus in der Gegenwart konfliktbeladen bleibt, wie es beispielsweise an der Diskussion um die Kongresshalle in Nürnberg deutlich wird, soll auch dieser Aspekt im Rahmen des Seminars beleuchtet werden.
Bachelor Seminar (Blockveranstaltung)
Termine
25. April 2025 von 10:00 bis 15:00
Einführungsveranstaltung im ATW Seminarraum (L3|01 315)
28. Juli 2025 von 10:00 bis 17:00 Uhr
29. Juli 2025 von 10:00 bis 17:00 Uhr
4. August 2025 von 10:00 bis 17:00 Uhr
5. August 2025 von 10:00 bis 17:00 Uhr
Master
Neben einer individualistischen Auffassung von Ernährung, bei der persönliche Essenspläne, Diäten, Vorlieben und die Lebensführung im Vordergrund stehen, sowie der Ernährung als existenzielle Überlebensstrategie, lassen sich Nahrungszubereitung und -aufnahme auch als zentrale Kulturtechniken verstehen: Kochen, Essen und Trinken als gemeinschaftliches Handeln und Erleben.
Neueren Studien zufolge verzeichnen jene Nationen, die während des Essens am wenigsten Zeit am Tisch oder in Gemeinschaft verbringen, die höchste Rate an Übergewichtigen. Demnach sollten folgende Klischees ernstgenommen werden: das Teilen von Mahlzeiten stärkt soziale Bindungen, fördert ein Gefühl der Zugehörigkeit und wirkt Einsamkeit entgegen, bewusstes Essen ist von großer Bedeutung für das Wohlbefinden von Leib und Seele und Genuss ein essentieller Lebensbestandteil, der allerdings auch zum Lifestyle erhoben und sogar Fetisch werden kann. Einerseits unterscheiden sich Essgewohnheiten und -gebote kulturell stark. Andererseits vereint die Bedeutung von Esskultur Menschen über alle Grenzen hinweg, was gerade in politisch schwierigen Zeiten und angesichts der Klima- und Biodiversitätskrise und mithin Lebensmittelkrise, umso wichtiger ist!
Im Fachmodul möchten wir Kochen, Essen und Trinken aber nicht nur als notwendige Vergnügen reflektieren, sondern insbesondere architekturhistorisch einprägsame Traditionen und Orte – Feuerstellen und Speisekammern, Küchen und Esszimmer, Speisesäle und Restaurants, Straßen und Städte – als Räume der gesellschaftlichen Reproduktion und kulturellen Distinktion thematisieren. Auch zunächst hintergründige Fragestellungen zu globalen Produktionsbedingungen und Lieferketten sollen gestreift und diskutiert werden: Wo und von wem werden Lebensmittel hergestellt, gehandelt, verarbeitet und aufbewahrt, bevor sie verspeist werden? In welchen räumlichen Settings wird Nahrung vor- und zubereitet, wo wird gegessen und getrunken? Wie werden Lebensmittel mit symbolischer, religiöser, kultureller Bedeutung aufgeladen und dadurch überhöht?
Die Input-Vorlesungen des Fachmoduls bieten einen Überblick zur Esskultur in der griechischen und römischen Antike, zum Essen und Trinken im Christentum, zum höfischen Tafelzeremoniell im Barock, zur Heilung durch Essen und Trinken in modernen Kurorten, zur Inszenierung der Haute Cuisine im Film, zum Kochen als urbane Gemeinschaftspraxis, sowie ein Gastbeitrag als kulinarischer Impuls aus der Gegenwartskultur.
Fachmodul Vorlesung
Termine
immer dienstags von 11:40 bis 13:10
22. April 2025 von 11:40 bis 13:10
Einführungsveranstaltung im Großen Hörsaal (L3|01 R93)
Sandra Meireis
Die Fachgebiete Architekturtheorie und -wissenschaft (ATW) und Digital Design Unit (DDU) bieten ein Seminar zum Verhältnis von Menschen und Maschinen in der Architektur gemeinsam an:
Seit es Werkzeuge gibt regt das Verhältnis von Mensch und Maschine die menschliche Fantasie an, zunehmend maschinell unterstützt. Mit der Digitalisierung vergrößert, vervielfältigt und verschmilzt ihr Grenzbereich fortschreitend und greift in alle Lebensbereiche hinein, aufgeladen mit vielerlei mythischen Vorstellungen. Auch in der Architektur arbeiten Menschen und Maschinen tagtäglich Hand in Hand – ihre Beziehung zueinander lässt sich an digitalgestützten Schreibtischen, Werkstätten und Baustellen beobachten. Ihre Schnittstellen funktionieren meist reziprok, wie beim Einspeisen von menschlichen Informationen in die Architekturmaschine (BIM) oder beim Implantieren bzw. Anheften maschineller Einheiten an Bauwerke oder menschliche Körper (Sensorik). Maschinelles lernen und generative KI verändern die Mensch-Maschine Kooperation bereits heute. Diesem Prozess liegen digitale Trainings- und Weltmodelle zugrunde, deren Algorithmen oft unzugänglich sind. Vermeintlich dem Menschen vorbehaltene kreative Prozesse und das autonome agieren in komplexen Kontexten werden zunehmend von Maschinen übernommen.
Im Seminar möchten wir die als technische Innovation verstandenen Werkzeuge im Prozess des Architekturschaffens kritisch reflektieren. Es soll ausgelotet werden, welche Freiheiten der architekturschaffende Mensch im Prozess der Digitalisierung gewinnt und welche Beschränkungen der Mensch durch die Maschine erfährt.
Das Seminar ist als Experimentierfeld gedacht, wo Theorie und Praxis zueinander finden und die Studierenden dahingehend ihren eigenen Schwerpunkt setzen können.
Der theoretische Bezugsrahmen umfasst sowohl klassische Referenzen, z.B. Norbert Wiener, Kybernetik. Regelung und Nachrichtenübertragung im Lebewesen und in der Maschine (1948), Gilbert Simondon Die Existenzweise technischer Objekte (1958), Lewis Mumford, The Myth of the Machine (1967/70), oder Nicholas Negroponte, Being Digital (1995), stellt aber auch Bezüge zur feministischen Technikphilosophie her, vertreten von Autor:innen wie Donna Haraway, Rosi Braidotti, Caroline Criado-Perez, Catherine d’Ignazio und Lauren F. Klein, Lucy Suchman oder Judy Wajcmann.
Der praktische Anteil umfasst das Erarbeiten eigener Mensch-Maschine-Modelle, bei der Sensoren die physische Umwelt wahrnehmen, die daraus resultierenden Daten verarbeiten und schließlich mittels Aktuatoren mit der physischen Welt interagieren.
Master Seminar
Termine
immer dienstags von 10:00 bis 11:30 Uhr
22. April 2025 von 10:00 bis 11:30 Uhr
Einführungsveranstaltung (L3|01 455)
Oliver Sukrow
Spätestens mit der Aufnahme der „Great Spas of Europe“ in die Welterbeliste der UNESCO sind historische Kurorte wieder mehr in das Blickfeld geraten. Die globale Covid-Pandemie hat ebenso dazu geführt, dass Orte und Räume der Gesundheit stärker wie vorher thematisiert werden. Wir wollen das gemeinsame Seminar von ATW und UDP dazu nutzen und uns aus verschiedenen Perspektiven einem Thema zu widmen, welches weniger präsent ist: der Bedeutung der Architektur nach 1945 für den Kurort. Anhand des Beispiels Bad Kissingen wollen wir – auch vor Ort – die Besonderheiten, Merkmale und Herausforderungen untersuchen, die ein Welterbe mit sich bringt, gerade auch für jenes Erbe, welches nicht zum Kanon gehört. Dazu werden wir uns auch mit der Entwicklung des Kurgedankens beschäftigen und aktuelle Planungen in und für Kurorte betrachten. Die Rechercheergebnisse des Seminars sollen in eine Ausstellung in Bad Kissingen zur Nachkriegsmoderne vor Ort einfließen. Im Wintersemester 25-26 ist ein Städtebauentwurf zu Bad Kissingen geplant. Eine Teilnahme am Seminar dient hierfür als Vorbereitung und wird daher empfohlen.
Im Rahmen einer Exkursion werden wir die Situation der Nachkriegsmoderne vor Ort in Bad Kissingen besichtigen und mit Akteur*innen vor Ort analysieren können. Ein genauer Termin wird zu Beginn der Lehrveranstaltung gemeinsam festgelegt. Für die Teilnahme an der Exkursion ist eine finanzielle Unterstützung von Seiten der TU Darmstadt vorhanden.
Master Seminar
Termine
immer dienstags von 9:50 bis 11:20 Uhr
22. April 2025 von 9:50 bis 11:20 Uhr
Einführungsveranstaltung im ATW Seminarraum (L3|01 315)